Über uns / Leistungen
Regelungen zum Praxisablauf
Für einen reibungslosen Praxisablauf bitten wir Sie, sich an die folgenden Regelungen zu halten:
- Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Ohne Termin kann es für Sie zu längeren Wartezeiten kommen, die wir gern vermeiden wollen. Falls Sie verhindert sind, bitten wir Sie um eine rechtzeitige Terminabsage
- Selbstverständlich behandeln wir Sie im Notfall auch ohne Termin. Bitte geben Sie in diesem Falle der Mitarbeiterin an der Anmeldung möglichst genaue Informationen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur das Notfallsymptom behandeln können.
- Denken Sie bei jedem Besuch in unserer Praxis an Ihre Versichertenkarte.
- Bringen Sie bitte auch alle Befunde von anderen Ärzten oder aus dem Krankenhaus mit.
- Bringen Sie bitte alle Medikamente mit, die Sie zurzeit einnehmen.
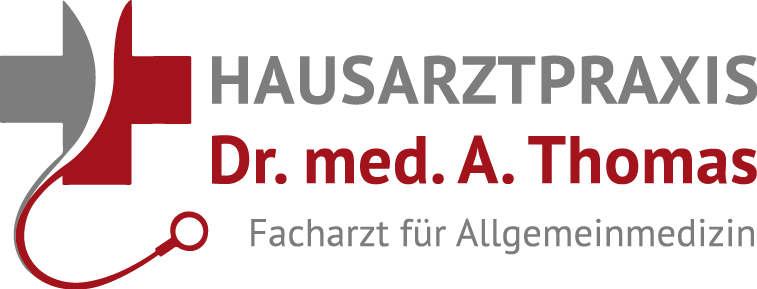
Allgemeinmedizinische Leistungen
Als allgemeinmedizinische Praxis bieten wir Ihnen ein breites Leistungsspektrum an. Sollten Sie Fragen zu unseren Leistungen haben, bitte sprechen Sie uns an!
Elektrokardiogramm
Ein Elektrokardiogramm (EKG) ist eine schmerzfreie Untersuchung, bei der die elektrische Aktivität deines Herzens aufgezeichnet wird. Auf der Brust (und teils an Armen und Beinen) werden kleine Klebeelektroden angebracht. Jede Herzmuskelzelle erzeugt bei ihrer Erregung winzige Stromimpulse – diese werden über die Elektroden aufgefangen und als Kurve auf Papier oder Bildschirm dargestellt.
Die typische EKG-Kurve besteht aus mehreren Abschnitten, den sogenannten P-, QRS- und T-Wellen:
P-Welle: Zeigt die elektrische Erregung (Depolarisation) der Vorhöfe.
QRS-Komplex: Stellt die rasche Erregung der Herzkammern dar; er ist der auffälligste Teil der Kurve.
T-Welle: Markiert die Erholungsphase (Repolarisation) der Kammern.
Es wird ein EKG genutzt, um den Herzrhythmus zu beurteilen (z. B. Vorhofflimmern oder Extrasystolen), Veränderungen der Herzmuskelfunktion (z. B. Herzinfarkt) zu erkennen oder die Wirkung von Medikamenten zu kontrollieren. Die Untersuchung dauert meist nur wenige Minuten und liefert sofort wichtige Informationen über die Herzgesundheit.
Langzeitblutdruckmessung
Bei der Langzeitblutdruckmessung (auch 24-Stunden-Blutdruckmessung genannt) wird der Blutdruck über einen gesamten Tag und eine ganze Nacht automatisch aufgezeichnet. Hierzu wird eine Manschette am Oberarm angelegt, die sich in festgelegten Intervallen (tagsüber in der Regel alle 15–30 Minuten, nachts alle 30–60 Minuten) selbsttätig aufbläst und misst. Die ermittelten Werte werden in einem kleinen Rekorder gespeichert.
Wesentliche Merkmale und Vorteile
Tages- und Nachtprofil: Das Blutdruckverhalten im Alltag einschließlich der nächtlichen Werte wird detailliert erfasst.
Aufdeckung von Weißkittel-Effekt und maskierter Hypertonie: Abweichungen, die ausschließlich in der Arztpraxis oder nur zu Hause auftreten, lassen sich identifizieren.
Therapiekontrolle: Die Wirksamkeit blutdrucksenkender Medikamente kann über den gesamten 24-Stunden-Zeitraum beurteilt werden.
Die Messung erstreckt sich meist über 24 Stunden (manchmal auch 48 Stunden). Dabei kann der gewohnte Alltag weitgehend fortgesetzt werden; nur starke Armbewegungen oder starkes Beugen des Arms sollten vermieden werden, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen. Nach Ablauf der Messdauer wird der Rekorder beim Arzt abgegeben und die gesammelten Daten werden ausgewertet, um den Blutdruckverlauf zu analysieren.
Spirometrische Untersuchungen der Lungenfunktion
Bei spirometrischen Untersuchungen der Lungenfunktion wird die Atmungsleistung mittels eines Spirometers ermittelt. Dabei atmet die untersuchte Person durch ein Mundstück in das Gerät, häufig unterstützt durch eine Nasenklammer, um alle Atemzüge über das Spirometer zu leiten. In Echtzeit werden Volumen und Fluss der eingeatmeten und ausgeatmeten Luft aufgezeichnet.
Zentrale Messgrößen
Vitalkapazität (VC): Gesamtmenge der Luft, die nach maximaler Einatmung aus der Lunge ausgeatmet werden kann.
Einsekundenkapazität (FEV₁): Volumen der Luft, das in der ersten Sekunde einer kräftigen Ausatmung bewegt wird.
Tiffeneau-Index (FEV₁/VC): Verhältnis von FEV₁ zur Vitalkapazität – wichtig zum Unterscheiden zwischen obstruktiven und restriktiven Mustern.
Peak-Flow (PEF): Maximale Ausatmungsgeschwindigkeit zu Beginn der Ausatmung.
Ablauf der Untersuchung
Ruheposition einnehmen und Mundstück mit fester Lippenumschluss ansetzen.
Tiefe Einatmung, dann so schnell und kräftig wie möglich ausatmen.
Vorgang wird meist mehrere Male wiederholt, um reproduzierbare Werte zu erhalten.
Bei Bedarf werden Bronchodilatatoren (z. B. Inhalationsspray) verabreicht und Messungen wiederholt, um die Reversibilität von Atemwegsverengungen zu prüfen.
Anwendungsgebiete und Nutzen
Diagnostik von Lungenerkrankungen: Unterscheidung zwischen Asthma (obstruktiv) und Lungenfibrose (restriktiv).
Verlaufskontrolle: Bewertung des Therapieverlaufs bei chronischen Atemwegserkrankungen.
Berufliche Eignungsuntersuchungen: Kontrolle der Lungenfunktion bei berufsbedingter Exposition (z. B. Staub, Chemikalien).
Die Untersuchung ist schmerzfrei, dauert in der Regel nur wenige Minuten und liefert unmittelbare Ergebnisse zur Beurteilung der Lungenfunktion.
Früherkennungsuntersuchungen
Bei Früherkennungsuntersuchungen handelt es sich um systematische Angebote zur rechtzeitigen Entdeckung von Krankheiten im Anfangsstadium, um durch frühzeitige Behandlung Komplikationen und Spätfolgen zu vermeiden.
Gesundheits-Check-up 35
Zielgruppe: Versicherte ab 35 Jahren, alle zwei Jahre
Untersuchungsumfang:
Anamnese (Risikofaktoren wie Rauchen, familiäre Vorerkrankungen)
Körperliche Untersuchung (z. B. Herz-Kreislauf-Status, Gewicht, Blutdruck)
Laboruntersuchungen (Blutbild, Blutzucker, Cholesterin)
Beratung zu Lebensstil, Prävention und Impfstatus
Hautkrebs-Screening
Zielgruppe: Versicherte ab 35 Jahren, alle zwei Jahre
Untersuchungsumfang:
Ganzkörperinspektion durch einen Hautarzt oder Dermatologen
Erhebung von Risikofaktoren (z. B. Sonnenbelastung, familiäre Hautkrebs-Vorfälle)
Dokumentation und gegebenenfalls dermatoskopische Untersuchung auffälliger Läsionen
Aufklärung zu Selbstuntersuchung und Sonnenschutzmaßnahmen
Darmkrebsvorsorge ab 50
Zielgruppe: Versicherte ab 50 Jahren
Leistungen: Koloskopie als Primäruntersuchung (Erstuntersuchung, dann je nach Befund alle 10 Jahre)
Immunologischer Stuhl-Okkultbluttest (iFOBT)
Zielgruppe: Versicherte ab 50 Jahren, jährlich als Alternative oder Ergänzung zur Koloskopie
Leistungen: Nachweis kleinster Blutmengen im Stuhl mittels spezifischer Antikörper-Testung
Beide Programme sind schmerzfrei, werden ambulant durchgeführt und über die gesetzlichen Krankenversicherungen abgedeckt. Eine regelmäßige Teilnahme erhöht die Chance, behandlungsbedürftige Befunde in einem frühen, gut therapierbaren Stadium zu erkennen.
Disease Management Programme (DMP)
Bei Disease-Management-Programmen (DMP) handelt es sich um strukturierte Behandlungsprogramme chronischer Erkrankungen, die nach einheitlichen, evidenzbasierten Leitlinien verlaufen. Ziel ist eine kontinuierliche, qualitätsgesicherte Betreuung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Haus- und Fachärzten, medizinischem Fachpersonal sowie ggf. anderen Gesundheitsberufen. Wesentliche Elemente sind standardisierte Diagnostik und Therapie, regelmäßige Verlaufskontrollen, Patientenschulung und Dokumentation.
DMP für ausgewählte Erkrankungen
Diabetes mellitus
Regelmäßige Kontrolle von Blutzucker (HbA₁c), Blutdruck und Lipidprofil
Schulungsprogramme zur Selbstmessung, Ernährung und Bewegung
Anpassung der Therapie nach aktuellen Leitlinien (z. B. Insulintherapie, orale Antidiabetika)
Jahresgespräche mit Dokumentation aller Parameter
Koronare Herzkrankheit
Überwachung von Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterin und Gewicht
Schulung zu Lebensstiländerungen (Raucherentwöhnung, körperliche Aktivität, Ernährung)
Einsatz von medikamentösen Sekundärpräventionsmaßnahmen (z. B. Betablocker, Statine, ASS)
Regelmäßige Belastungs- oder Ruhe-EKG-Kontrollen
Asthma bronchiale
Lungenfunktionskontrollen (z. B. Spirometrie, Peak-Flow-Messung)
Schulung zu Inhalationstechnik, Medikation und Asthmakontrolle
Erstellung eines individuellen Aktionsplans für Exazerbationen
Regelmäßige Überprüfung der Symptomkontrolle und Anpassung der Therapie
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
Regelmäßige Lungenfunktionsmessungen (FEV₁, FEV₁/VC)
Schulung zu inhalativen Medikamenten, Atemtechniken und körperlichem Training
Impfungen (Influenza, Pneumokokken) und Raucherentwöhnungsprogramme
Überwachung des Krankheitsverlaufs und Exazerbationsprävention
Jedes Programm ist langfristig angelegt und fördert die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten sowie eine enge ärztliche Begleitung zur Optimierung der Behandlungsergebnisse.
Impfungen
Bei Impfungen handelt es sich um vorbeugende Maßnahmen, mit denen das Immunsystem zum Aufbau eines spezifischen Schutzes gegen bestimmte Infektionserreger angeregt wird. In Deutschland orientiert sich die Impfempfehlung an den Richtlinien der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut.
Wichtige Impfungen
Grippeschutz (Influenza-Impfung)
Empfohlen: Jährlich, idealerweise im Herbst
Zielgruppen: Personen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Schwangere ab dem zweiten Trimenon, medizinisches Personal, Pflegekräfte
Wirkstoff: Inaktivierter Virusimpfstoff oder adjuvantierte/zellkulturbasierte Varianten
Tetanus
Grundimmunisierung: Drei Dosen Kombinationsimpfstoff (z. B. DTPa) im Säuglingsalter
Auffrischung: Alle 10 Jahre mit einem Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfstoff
Indikation: Jeder Kontakt mit potenziell kontaminierten Wunden, Unfallverletzungen
Hepatitis
Hepatitis B
Grundimmunisierung: Drei Dosen im Erwachsenenalter (0, 1, 6 Monate)
Catch-up: Empfohlen für medizinisches Personal, Reisende in Endemiegebiete, Risikogruppen (z. B. Dialysepatienten)
Hepatitis A
Grundimmunisierung: Zwei Dosen (0, 6–12 Monate)
Indikation: Reisende in Hochrisikogebiete, Lebererkrankte, enge Haushaltskontakte von Hepatitis-A-Erkrankten
Herpes zoster (Gürtelrose)
Empfohlen: Zwei Dosen eines adjuvantierten Totimpfstoffs
Zielgruppe: Personen ab 60 Jahren; ab 50 Jahren bei schwerer Grunderkrankung oder Immunsuppression
Abstand: 2–6 Monate zwischen den Dosen
Pneumokokken
Empfohlen:
Konjugatimpfstoff (13-Valent) einmalig für Säuglinge im Rahmen der Grundimmunisierung
Polysaccharidimpfstoff (23-Valent) als einmalige Auffrischung ab 60 Jahren bzw. bei Risikogruppen
Zielgruppen: Kleinkinder, ältere Erwachsene und Personen mit erhöhtem Risiko für invasive Pneumokokkenerkrankungen
HPV (Humanes Papillomavirus)
Empfohlen: Zwei oder drei Dosen eines Vier- oder Neun-valenten Virus-Like-Particle-Impfstoffs
Zielgruppe: Jugendliche im Alter von 9–14 Jahren (Jungs und Mädchen), Catch-up bis 17 Jahren
Schutz: Vor akuten und persistierenden HPV-Infektionen sowie HPV-assoziierten Krebsvorstufen
Alle genannten Impfungen sind in der Regel gut verträglich und werden von den gesetzlichen Krankenkassen gemäß den STIKO-Empfehlungen erstattet. Eine frühzeitige und vollständige Immunisierung verbessert den individuellen und den Gemeinschaftsschutz („Herdenimmunität“).
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
Wir bieten Ihnen auch medizinische Leistungen an, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht finanziert werden und die daher von Ihnen selbst bezahlt werden müssen.
Sollten Sie Interesse an diesen Leistungen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterin an der Anmeldung oder sprechen Sie mich direkt an.
Reisemedizinische Beratung
Bei reisemedizinischer Beratung und Impfungen handelt es sich um eine individuell zugeschnittene Präventivmaßnahme vor Auslandsreisen. Sie umfasst eine Risikoanalyse anhand von Reiseziel, Reisezeit, Art der Unterkünfte und persönlichen Faktoren sowie die Planung sinnvoller Impfungen und weiterer Prophylaxemaßnahmen.
Kernbestandteile der reisemedizinischen Beratung
Anamnese und Risikobewertung
Abfrage von Reiseziel, -dauer und Reisezeitpunkt
Geplante Aktivitäten (z. B. Dschungel-, Wüsten- oder Bergtouren)
Vorerkrankungen, Allergien und aktuelle Medikation
Impfberatung
Prüfung des Standardimpfschutzes gemäß STIKO (Tetanus, Diphtherie, Polio, Masern/Mumps/Röteln)
Empfehlung reisespezifischer Impfungen:
Gelbfieber
Hepatitis A
Hepatitis B
Typhus
Tollwut
FSME (bei Reisen in Risikogebiete Mitteleuropas)
Cholera
Japanische Enzephalitis
Meningokokken (z. B. für Pilgerreisen nach Mekka)
Medikamentöse Prophylaxe
Malariaprophylaxe (je nach Resistenzlage und Reisegebiet)
ggf. Stand-by-Antibiotika bei Durchfallerkrankungen
Verhaltens- und Hygienetipps
Trinken nur von abgefülltem oder sicher aufbereitetem Wasser
Vorsicht bei Straßenküchen und rohen Lebensmitteln
Insektenschutz (Repellents, Moskitonetze, imprägnierte Kleidung)
Sonnenschutz und Dehydrierungsprophylaxe
Zusammenstellung der Reiseapotheke
Basis-Medikamente (Schmerzmittel, Antihistaminika, Durchfall- und Erkältungsmittel)
Verbandsmaterialien und Desinfektionsmittel
Persönliche Dauermedikamente in ausreichender Menge
Dokumentation
Aktualisierung des Impfpasses
Internationale Impfnachweise (z. B. Gelbfieber-Impfbescheinigung)
Atteste für Mitnahme von Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln
Eine sorgfältige reisemedizinische Beratung trägt maßgeblich dazu bei, gesundheitliche Risiken im Urlaub zu minimieren und das Reiseerlebnis unbeschwert zu genießen.
Bescheinigungen für Kita, Schule & Sportverein
Bei Bescheinigungen für Kita, Schule und Sportverein handelt es sich um offizielle ärztliche oder verwaltungsrechtliche Nachweise, die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben oder von den Trägern gefordert werden. Sie dienen der Sicherstellung von Gesundheitsschutz, Teilnahmeberechtigung und Haftungsfreistellung.
Kita
Gesundheitsbescheinigung (U-Untersuchungen): Nachweis über erfolgte Vorsorgeuntersuchungen (U1–U9), insbesondere U7a/U8, gemäß Früherkennungsrichtlinie.
Masernschutzbescheinigung: Bestätigung über vollständigen Impfschutz gegen Masern oder Immunität, Pflicht seit März 2020.
Attest bei Krankheit: Beanstandungsfreie Belastbarkeit nach fieberhaften Infekten oder ansteckenden Erkrankungen (z. B. Magen-Darm-Infektionen).
Medikationsplan: Arbeitsfähigkeitsbescheinigung und Anordnung zur Arzneimittelgabe während der Betreuungszeit.
Schule
Schulunfähigkeitsbescheinigung: Ärztliches Attest zur Vorlage bei längerer Erkrankung (ab dem dritten Fehltag).
Sportunfähigkeitsattest: Bescheinigung über vorübergehende oder dauerhafte Einschränkungen im Sportunterricht.
Masernschutznachweis: Ebenfalls Pflicht nach dem Infektionsschutzgesetz für alle schulpflichtigen Kinder.
Impfpasskontrolle: Bestätigung zum Nachweis vollständiger Standardimmunisierungen (z. B. DTP, MMR).
Sportverein
Sporttauglichkeitsbescheinigung: Ärztliches Attest, das die allgemeine körperliche Eignung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb bestätigt.
Herz-Kreislauf-Check: Oft gefordert als Teil des Attests – z. B. Ruhe-EKG und Blutdruckmessung.
Jugendschutzbescheinigung: Bei Trainingslagern oder Freizeiten außerhalb des Heimatorts, u. U. mit ergänzendem Impfnachweis.
Haftungsfreistellung: Formulare des Vereins, die auf Basis der ärztlichen Bescheinigung ausgefüllt werden, um Risiken beim Sport abzudecken.
Berufseingangsuntersuchung
Bei einer Berufseingangsuntersuchung handelt es sich um eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung vor Aufnahme einer Tätigkeit mit besonderen gesundheitlichen Anforderungen. Sie dient der Feststellung, ob gesundheitliche Risiken für die oder den Beschäftigten oder für Dritte bestehen, und der Beratung zu möglichen präventiven Maßnahmen.
Rechtsgrundlage
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV-Grundsatz G-25 u. a.)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
Ziele
Kompetenz- und Einsatzfähigkeit für die vorgesehene Tätigkeit prüfen
Erkennen und Beraten zu berufsbedingten Gesundheitsrisiken
Festlegen ggf. notwendiger Schutzmaßnahmen oder Einschränkungen
Inhalte der Untersuchung
Anamnese und Risikofragebogen: Erhebung von Vorerkrankungen, Allergien, frühere Berufstätigkeiten und individuelle Risikofaktoren
Körperliche Untersuchung: Allgemeinzustand, Herz-Kreislauf (inkl. Blutdruckmessung), Atmung, Bewegungsapparat
Fachärztliche Tests je nach Tätigkeit:
Sehtest (visuelle Anforderungen, Farbsichtigkeit)
Hörtest (bei Lärmbelastung)
Lungenfunktion (z. B. Spirometrie bei Stäuben, Gasen)
Laborkontrollen (Blutbild, ggf. Leber-/Nierenwerte)
Beratung: Hinweise zu gesundheitsgerechtem Verhalten, ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung, ggf. individuelle Schutzkleidung oder -technik
Dokumentation: Ausstellung einer Bescheinigung über die Eignung („geeignet“, „bedingt geeignet“, „nicht geeignet“) und Empfehlungen für Folgeuntersuchungen
Nachuntersuchungen
Abhängig von den Befunden und der Gefährdungsbeurteilung können regelmäßige arbeitsmedizinische Kontrollen (z. B. G-Untersuchungen) erforderlich sein.
Führerscheinzeugnis
Bei einem Führerscheinzeugnis handelt es sich um eine ärztliche Bescheinigung zur Fahreignung, die für bestimmte Führerscheinklassen oder nach speziellen Anforderungen vorgeschrieben ist. Sie dient dem Nachweis, dass keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen, die das sichere Führen von Kraftfahrzeugen gefährden.
Rechtsgrundlage und Anwendungsbereich
Gefordert für Fahrerlaubnisklassen C, CE, D, DE (Lkw und Busse) sowie z. T. für Personen mit bestimmten Vorerkrankungen oder nach Unfällen
Grundlage: Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Anlage 5 „Gesundheitliche Anforderungen“
Untersuchungsumfang
Anamnese und Befragung: Erfassung von Vorerkrankungen (z. B. Diabetes, Epilepsie), Medikamenteneinnahme und Unfallvorgeschichte
Sehtest: Visusprüfung (min. 70 % Sehschärfe pro Auge oder 100 % beidäugig); ggf. Farb- und Gesichtsfeldtest
Hörtest: Tonaudiometrie oder Stimmgabeltest, wenn in der Vergangenheit Auffälligkeiten vorlagen
Körperliche Untersuchung: Blutdruck, Herz-Kreislauf-Status, neurologische Basisuntersuchung
laborchemische Basisuntersuchungen: Blutbild, Blutzucker, ggf. Urinstatus (je nach Alter, Risiko und Klassenanforderung)
Ergebnis und Dokumentation
Ausstellung des Führerscheinzeugnisses auf amtlichem Vordruck (ärztliches Gutachten gemäß FeV)
Einstufung in „geeignet ohne Auflagen“ oder „geeignet unter Auflagen“ (z. B. Brillenträger, regelmäßige Nachkontrollen)
Gültigkeit meist zwei bis fünf Jahre, danach ggf. Wiederholungsuntersuchung erforderlich
Zielsetzung
Sicherstellung, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen das Unfallrisiko nicht erhöhen
Nachvollziehbare Dokumentation für Fahrerlaubnisbehörden und Arbeitgeber (z. B. Berufskraftfahrer)
Gegebenenfalls frühzeitiges Erkennen von Erkrankungen mit Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit
Ein vollständiges Führerscheinzeugnis gewährleistet, dass körperliche und geistige Voraussetzungen für das Führen von Kraftfahrzeugen erfüllt sind und trägt so zur allgemeinen Verkehrssicherheit bei.
Kinesio Taping
Bei Kinesio-Taping handelt es sich um eine physiotherapeutische Methode, bei der elastische Baumwollbänder (Tapes) auf die Haut aufgebracht werden, um muskuläre, fasziale und gelenkbezogene Funktionen zu unterstützen.
Grundprinzip
Elastizität: Die Tapes besitzen eine Dehnbarkeit von bis zu 120 % und imitieren damit die Eigenschaften der menschlichen Haut.
Anlagetechnik: Das Tape wird in vordefinierten Spannungszonen (je nach gewünschter Wirkung) auf die saubere, fettfreie Haut geklebt.
Wirkmechanismen
Propriozeptive Stimulation: Verbesserung der Eigenwahrnehmung von Muskeln und Gelenken durch ständigen Hautkontakt.
Entlastung und Unterstützung: Verminderung von Zugkräften auf Gewebe oder Stabilisierung schwacher Muskelpartien.
Förderung der Mikrozirkulation: Anhebung der Hautfalten zwischen Haut und Faszie zur Verbesserung von Blut- und Lymphfluss.
Anwendungsgebiete
Muskel- und Gelenkschmerzen: z. B. Schulter-, Knie- oder Rückenbeschwerden
Verletzungsprophylaxe: Unterstützung bei Überlastungssyndromen und im Sport
Schwellungen und Ödeme: Lymphabfluss fördernd bei pre- und posttraumatischen Schwellungen
Haltungs- und Bewegungsoptimierung: Korrektur fehlerhafter Haltungs- oder Bewegungsmuster
Durchführung
Haut vorbereiten (reinigen, ggf. leicht entfetten).
Tape je nach Indikation in Y-, X- oder I-Form zuschneiden.
Mit vorgedehnter oder anliegeloser Technik aufkleben.
Tragedauer: in der Regel 3–5 Tage, auch unter Dusche oder beim Sport beständig.
Kontraindikationen und Hinweise
Allergische Reaktionen auf Klebstoffe oder empfindliche Haut
Offene Wunden, Hautinfektionen oder Thromboseverdacht
Bei Vorerkrankungen (z. B. Gefäß- oder Hauterkrankungen) vorher ärztlichen Rat einholen
Kinesio-Taping ergänzt die physiotherapeutische Behandlung, indem es über einen längeren Zeitraum gezielte Reize setzt und so Heilungsprozesse und Funktionsverbesserungen unterstützen kann.